Ordnungspolitische Dialoge
In dieser Rubrik finden Sie Berichte von den „Ordnungspolitischen Dialogen“, einer internationalen Konferenzreihe zur Ordnungspolitik in Zwickau und an anderen Orten. Diese hat sich seit 2007 etabliert und wird von den Initiatoren des Ordnungspolitischen Portals in Zusammenarbeit mit der Universität Tartu in Estland sowie der Hanns Seidel Stiftung in Seoul veranstaltet.
8th Dialogue on Social Market Economy:
Role of Higher Education
in Different Economic Systems
In the conditions of austerity-driven budgets, it has become ever more necessary to explain the general public why investments in R&D are necessary for sustaining the social, economic, cultural development of different countries. In the world of fake news and misinformation, being a center creating the evidence-based or theory-based knowledge, the role of universities widens besides the traditional missions of teaching, research and societal service. To cope with all the above aims, but also more practical challenges of rising costs, speeding up knowledge transfer, but also declining completion rates, the universities need to embrace new, more integrated technological and management models. Universities in different countries face challenges for exercising their autonomy and academic freedom. These are the few topics, which do not constitute a complete list of topics the conference is trying to address.


To discuss these questions the 8th Dialogue on Social Market Economy took place at University of Tartu, School of Economics and Business Administration, from 30 January to 1 February 2020. The following presentations were given:
- Wolf Schäfer - The production of knowledge by academic institutions
- Armin Rohde, Ole Janssen - Innovation Policy in the Social Market Economy
- Ralph Wrobel - Independence of science: different models in comparison
- Rolf Hasse - Economics and Educational Sciences: Are the Targets Really so different?
- Helge Löbler - The future of Entrepreneurship-Education
- Tanel Hirv - Factors affecting scientific impact: comparison of European countries
- Mariia Chebotareva - FOCJ as an opportunity of municipalities to cooperate in the Russian school education sector
- Peter Friedrich, Diana Eerma - How to use social accounting to measure the social capital (Tartu university case)
- Herbert Woratschek - Essentials are Invisible! - Why does the logic of value co-creation in the sport value framework represent a logic of success?
- Kadri Männasoo, Artjom Saia - Individuals’ Digital Capacity and Labour Market Outcomes: Comparative evidence from Europe
- Tõnis Eerme - Participation in the programs of the European Space Agency - Effects and additionality from the viewpoint of a small open economy
- Kadri Ukrainski - Attempting to develop research organizations with the project-funding instruments: the case of Estonia
- Raul Eamets - Estonian HE vision
- Jüri Sepp - Performance Funding of Universities – The Case of School of Economics and Business Administration
- Toomas Haldma, Kaspar Kalpus - Performance measurement at the universitieswithin the sustainability management framework
- Karin Jaanson - Research Funding System in Estonia
- Diana Eerma - Innovator in education and leadership
Photos:




Globalization failed?
New Approaches to a Free International Order

Date: November 14-16 2018, Venue: Seoul National University, Seoul / South Korea
On account of a mixture of different aspects, such as the quick and easy transportation by train or airplane, the internet and the common interest to interact and learn from each other, we now may find ourselves living in a thoroughly connected, globalized world. However, it hasn’t always been like that and at this very moment it seems to be changing. In times of protectionism and populism, which can be experienced all around the world, however, the question has to be raised whether the approach towards globalization, which was originally aimed to achieve, might have failed. Instead new approaches to a free international order should be taken into consideration which was the underlying goal of the 7th Dialogue on Social Market Economy. This year’s conference with the title “Globalization failed? – New Approaches to a Free International Order.” took place at the Seoul National University in Seoul, Korea, which is well-known as one of the three top universities in South Korea.
The first day of the conference, November 14th, was opened by Prof. Dr. Seung-Jong Lee, the Dean of Seoul National University, as well as by Dr. Luther, the head of the HSF institute for international cooperation, who was staying in Korea for a two-week field trip. Prof. Dr. Lee covered in his speech the results of previous conferences of the “Ordnungspolitische Dialoge”, as well as mentioned today’s global political situation and its resulting impediments. Dr. Luther focused in her speech more on the case of South and North Korea and emphasized the required change in opening up the North Korean economy. Therefore, she described an analogy to the times of German division by stating that “the East German transformation was very painful, but ultimately is was successful and made Germany and Bavaria stronger, based on a market-approach.”
The opening speeches were then followed by the Keynote speech hold by Prof. Dr. Young-Hoon Paik, the President of Korean Industrial Development Institute. He started off by explaining Korea’s situation in 1960s, when the Korean war was over, but the country was still suffering from its aftermaths. He ended his speech by specifically emphasizing the significance of the German concession of financial aid to South Korea, as well as the economic guidance by Ludwig Erhard, the father of Social Market Economy, to achieve the Korean dream of economic prosperity.
After a short break, the first session regarding globalization started, which was moderated by Dr. Seliger. In the first presentation by Prof. Dr. Yalamova, Associate Professor of the University of Lethbridge, she talked about blockchain, a technology well-known for its fundamental usage in the Bitcoin system, as it records transactions constantly, which can’t be erased but is sequentially updated. In her presentation she considered its application to the polycentric governance of socio-economics as well as sheds light on its negative aspects. As second speaker Prof. Hirasawa of the Nihon University provided insight into the negative effects of globalization on small and middle-sized companies (SMEs). He explained that multinational enterprises (MNEs) may produce huge quantities of products, which on account of economies of scale lead to cost savings and excess capital. In conclusion he stated, that this excess in capital results in international investments and intensified competition deteriorating conditions of SMEs and Start-ups.
After a short tour through the Seoul National University Campus, the second session by the name of “Globalization II” took place, which was picked up where Prof. Hirasawa left off earlier that day. Under the moderation of Prof. Dr. Sepp, this session started with the presentation about changes in international trade patterns by Prof. Dr. Wrobel of the University of Applied Sciences Zwickau. Therefore, he analyzed the vertical and horizontal intra industry trade between the three economic centers, which are North America, Europe and East Asia, as well as investigated the application of two theorems by Heckscher-Ohlin and Stolper-Samuelson. Prof. Dr. Wrobel summarized his presentation with “The China Effect”, which implies that Chinese labor-intensive exports are shrinking while vertical intra-industry trade is increasing. Prof. Dr. Neves of Universidade Autónoma de Lisboa analyzed neo-liberal adjustment policies as impediments to long term growth, equality and social cohesion in small states by the example of Portugal. His results showed that neo-liberal adjustment policies, as applied to Portugal in 2011-2014, lacked consideration on long-term impacts on aspects, such as growth, social cohesion, human rights and political sustainability. The last speaker of the day was Prof. Dr. Varblane, a professor at the University of Tartu. In his speech he defined populism from an economic perspective and identified globalization to be the main cause for today’s popularity of populists. Also, he analyzed the people who voted for Brexit, the promises made by populists as well as the implications of the vote for the UK. After drafting the possible outcomes of a soft or hard Brexit, he closes his talk by recommending that a common solution for Brexit by the end of November 2018 shall be found.
The following day started with the Keynote speech by Prof. em. Dr. Dr. h.c. Sung-Jo Park, who compared in his talk the social market capitalism in Germany with the state capitalism in South Korea and analyzed the divergencies as well as convergences.
In the first session of the day, which focused on North Korea, Prof. Dr. Wierzbowski, Professor at the Hankuk University of Foreign Studies, described the general economic situation of DPRK, also considering the implemented sanctions and how they are being circumvented. Moreover, he briefly provided a summary on economic developments, e.g. market growth as well as price changes. Dr. Seliger, the Resident Representative of the Hanns Seidel Foundation Korea, moved on by talking about the difficulty of maintaining the North Korean planned economy without actual underlying data and the basics of the political economy and hybrid socialism in North Korea. In addition, he provides essential background information on North Korea’s leader cult and its class-based society. At last, the Prof. Jung of Seoul National University presented his ideas regarding the re-education for government officials of North Korea after the Unification of the Korean Peninsula. After introducing the corresponding theory, and the political and administrative structure in the DPRK, in a second step he took a closer look at the German reunification process and looked for analogies to Korea. Eventually, he summarized the measures to be undertaken.
After lunch the session called “Economics and political topics in the EU” took place with the presenters being Prof. Dr. Vadi, Prof. Dr. Ukrainski, both professors of the University of Tartu, and Mr. Hess, a doctorate student of the University of Erfurt. Prof. Dr. Vadi, who covered the interesting subject of cultural learning theories by the example of Estonia’s prime ministers (PMs), conducted interviews with six out of ten former Estonian PMs since 1991. During the presentation she split up the information gathered into the different life stages and demonstrated the results and thus, finished by answering the question whether there is something new for cultural learning theory. Prof. Dr. Ukrainski intended to research the internationalization of firms R&D activities by analyzing the countries’ subcommunities, identifying role patterns that firms from different countries play in H2020, as well as comparing the number of connections of business sectors of EU15 and EU13 in H2020. Her conclusion is that Germany is the only one hub-country, and that other countries, especially EU 13 members, tend to be peripheral. As the last speaker of this session, Mr. Hess considered another economic perspective by taking a look at people’s happiness and what kind of role the welfare state plays in it. Based on past statements being supported by the World Happiness Report, Mr. Hess assumes that there exists a connection. He even suggests that the ultimate objective of public policy might be wellbeing, which shall function as a mean to investigate economic policy measures.
The final session of the 7th Dialogue on Social Market Economy considered regulatory and economic perspectives. Mr. Kretschmer made a start by presenting Karl Polanyi’s pendulum, which states that there are two phases in which either markets are restricted or liberalized. Based on this assumption Mr. Kretschmer raised the question whether this had an influence on topics of economic research. Based on May and Nölke’s calendar on liberal and organized periods, Mr. Kretschmer analyzed the usage of key words in the respective periods leading to the result that there may exist Polanyi’s Pendulum also in economic literature. The next speaker is Prof. Paik, Professor of the Chung-Ang University, who compared in his paper the German Basic Law and the Constitution of the U.S. and ROK, as well as the competition laws prevailing in Germany, U.S. and Korea. Based on these analyses, Korea has more similarities to the U.S. than to the German competition laws. Also, it is indicated that there are no principles of the Social Market Economy implemented in Korea. Consequently Prof. Paik, recommends reconsidering Korean policy ideology. As interdisciplinary approach Mr. Schneegans, a Master student of Psychology, who was not able to join the conference in Seoul, presented his paper with the topic of filter bubbles on Social Media via conference call. After explaining the different existing filters, e.g. the technological, social and cognitive ones, and their perils, he then finishes his presentation by advising on how to deal with these different filter bubbles in general, as well as by giving recommendations for individual reflection.
Excursion to the North Korean Border




Arbeitsmarktentwicklung und -regulierung in vergleichender Perspektive
Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel sind zurzeit in Europa gleichzeitig große Probleme. Die Entwicklungen auf den weltweiten Arbeitsmärkten sind gleichzeitig sehr unterschiedlich. Wie haben sich seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 die Arbeitsmärkte in Sachsen, Deutschland, Europa und der Welt entwickelt? Inwieweit sind unterschiedliche Arbeitsmarktregulierungen dafür verantwortlich? Welche Auswirkungen hat dies auf die Arbeitskräfte und die Unternehmen? Um diese Fragen zu beantworten, sind vom 28. bis zum 30. Oktober 2015 Wissenschaftler aus den Bereichen Betriebs- und Volkswirtschaftslehre sowie Praktiker zu Diskussionen in Zwickau zusammenkommen. Die Gäste kamen aus Südkorea, Estland, Polen, der Tschechischen Republik und Deutschland. Eine Rednerin wurde online aus Finnland dazu geschaltet. Die Workshops wurden in deutscher und englischer Sprache abgehalten.
v.l.n.r.: Herr Wunderlich (IHK Chemnitz), Prof. Sepp (Uni Tartu), Prof. Baier (WHZ), Prof. Wrobel (WHZ), Prof. Walter (WHZ), Prof. Kassel (WHZ), Prof. Kolev (WHZ), PD Dr. Seliger (HSS Korea), Prof. Behr (WHZ).
Die Konferenz gliederte sich in eine Plenarsitzung, welche am Donnerstagnachmittag stattfand, und mehrere Workshops am Donnerstag und Freitag. Dabei wurde in der Plenarsitzung v.a. auf die Arbeitsmarktentwicklung in Ostdeutschland und speziell Sachsen fokussiert. In den Workshops wurden dann aus betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Perspektive unterschiedliche Fragestellungen zum Thema diskutiert. Während es in den Workshops 1a und 1b am Donnerstagnachmittag um das „Matching" von Unternehmen und Fachkräften ging, wurden in den Workshops 2, 3, 5 und 6 v.a. unterschiedliche Fragen aus volkswirtschaftlicher Perspektive aufgeworfen: Welche arbeitsmarktpolitischen Probleme gibt es derzeit in Deutschland, kann man wirklich von Fachkräftemangel sprechen? Welche Rolle spielt die derzeitige Immigration dabei? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen nachhaltiger Entwicklung und der Schaffung neuer Arbeitsplätze? Welche Besonderheiten gelten für die Arbeitsmärkte in Mittel- und Osteuropa sowie in Nordkorea? In Workshop 4 wurden zudem weitere Fragen des Human Resource Management aufgeworfen, insbesondere Fragen betreffend der Integration von Hochschulabsolventen in das Arbeitsleben.
Plenarsitzung „Arbeitsmarktentwicklung in Ostdeutschland – Herausforderungen, Probleme und Strategien für die Region"
Zu Beginn der Plenarsitzung wurden die Gäste und Zuhörer von den Veranstaltern, vertreten durch Frau Prof. Dr. Walter und Herrn Prof. Dr. Wrobel, begrüßt. Kurze Grußworte hielten zudem der Prorektor der WHZ, Prof. Dr. Baier, und der Dekan der Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Prof. Dr. Kassel. Dann sprachen Prof. Dr. Michael Behr (WHZ und Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft), Herr Hans-Joachim Wunderlich (Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz) sowie die Studentinnen der WHZ Heidi Ackermann und Aline Knaak.
Prof. Dr. Behr beim Vortrag in der Plenarsitzung
Wie Prof. Behr in seinem Vortrag „Arbeitsmarktentwicklung in Ostdeutschland - Herausforderungen, Probleme und Strategien für die Region" deutlich machte, hat der Arbeitsmarkt in den neuen Bundesländern seit der Wende drei Phasen durchlaufen: 1.) Eine Phase radikaler und heftiger Verwerfungen in den ersten 15 Jahren, die auch durch Massenabwanderungen und Einbrüche bei den Geburtenraten gekennzeichnet war. 2.) Seit ca. 2005 beobachtet man eine deutliche Umkehr zum Positiven mit fallenden Arbeitslosenzahlen und sich verbessernder Demografie. 3.) Seit kurzem wird durch das altersbedingte Ausscheiden großer Kohorten aus dem Arbeitsmarkt in bestimmten Branchen und Regionen Ostdeutschlands ein Fachkräftemangel deutlich spürbar. Ausgehend von einem von Prof. Behr erläuterten Portfolio können verschiedene Regionen von wirtschaftlich stark bis schwach und von demografisch stark bis schwach eingeordnet werden. Sachsen, und dabei Westsachsen insbesondere, gehöre zu den Regionen, die wirtschaftlich stark, aber demografisch eher als schwach zu charakterisieren sind.
Herr Wunderlich stellte in seinem Vortrag „Nachwuchskräftebedarf in der mittelständischen Wirtschaft Westsachsens" den deutlich spürbaren Fachkräftemangel in der Region in den Vordergrund. Die westsächsische Wirtschaft würde daher in der Flüchtlingskrise eine klare Chance für die Region sehen, wenn nur die Integration der Flüchtlinge gut angegangen würde. Wie in der anschließenden Diskussion deutlich wurde, ist der Fachkräftemangel in der Region aber teilweise auch „hausgemacht". So seien die Unternehmen gewohnt, preisgünstig Fachkräfte einstellen zu können und würden sich nur schwer darauf umstellen, mehr an Entgelt zu bezahlen sowie bessere Arbeitsbedingungen zu bieten. Die alterszentrierte Belegschaftsstruktur in vielen Unternehmen der Region wurde auch aus der Präsentation der beiden Studentinnen der WHZ zum Thema „Alternde Belegschaften und Wissenstransfer in einem westsächsischem KMU - Ergebnisse des studentischen Praxisprojektes 2015" deutlich. Wie sie herausarbeiteten, wird sich bis 2025 der Personalbestand im untersuchten Unternehmen stark reduzieren, so dass mit sehr hohem Wissensverlust zu rechnen ist und eine Integration junger Nachwuchskräfte dringend notwendig wird.
Workshops 1a und 1b: Unternehmen suchen Fachkräfte -Fachkräfte suchen Unternehmen. Praktiker und Studierende im Dialog
Anliegen der Workshops 1a und 1b war am ersten Konferenztag die Fortsetzung des Dialoges zwischen verschiedenen Akteuren des Arbeitsmarktes, der mit der Regionalkonferenz 2014 im Rahmen der Wissenschaftsregion Chemnitz an der WHZ begonnen wurde. Damit wurde den Erwartungen der regionalen Wirtschaft hinsichtlich des intensiveren „Aufeinanderzugehens" bei der Integration von akademischen Nachwuchskräften entgegen gekommen. Moderiert wurden die Workshops von Frau Prof. A. Walter und Dipl.-Kfm. M. Haubold, Career Service der WHZ, sowie von Dipl.-Kfm. S. Freudenberg und Frau Dr. S. Stephan, NCCM Dresden. In beiden Workshops gab es eine überaus angeregte Diskussion zu folgenden Fragen: Was funktioniert beim Übergang in den Beruf nach dem Studium bereits? Was kann besser gestaltet werden? Welche Erwartungen und Ziele gibt es bei allen Beteiligten? Als wichtigstes Ergebnis wurde festgehalten, dass es teilweise immer noch sehr unterschiedliche Erwartungen der Studierenden und regionaler Arbeitgeber an die jeweils andere Seite beim Berufseinstieg gibt, die zu Unsicherheiten im Umgang miteinander führt. Junge Akademiker wünschen sich neben angemessenem Gehalt vor allem auch immaterielle Anreize, wie ein von gegenseitigem Respekt und Offenheit geprägtes Arbeitsklima, flexible Arbeitszeiten und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.
Betriebswirtschaftliche Vorträge
In ihren wissenschaftlichen Vorträgen gingen die Personalwirtschaftsexperten v.a. auf strategische Konzepte und Gestaltungsalternativen für Arbeitgeber mit Fachkräftebedarf in verschiedenen europäischen Regionen sowie auf die wechselseitigen Erwartungen von Unternehmen und Hochschulabsolventen beim Berufseinstieg ein.
In dem Vortrag von Frau Prof. Walter, WHZ, ging es unter dem Titel „Employer Branding für kleine und mittelständische Unternehmen - eine Personalstrategie für Recruiting und Bindung junger Fachkräfte in Zeiten des demografischen Wandels" um die Frage, inwiefern diese personalwirtschaftliche Strategie auch in regionalen mittel-ständischen Unternehmen geeignet ist, das betriebliche Angebot an Arbeitsplätzen und die Nachfrage von Hochschulabsolventen nach adäquaten Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region Westsachsen zusammenzuführen. Ergebnisse der eigenen empirischen Studie 2014 bestätigen, dass mehr als die Hälfte der WHZ-Absolventen eine Beschäftigung in der Region suchen. Deshalb können Unternehmen mit der Verbesserung ihrer Attraktivität als Arbeitgeber bei Bedarf kurzfristig junge Fachkräfte gewinnen und binden. Voraussetzung dafür ist das Wissen über die Erwartungen von jungen Akademikern der Generation Y, die ebenfalls Gegenstand der empirischen Studie waren.
Frau Dr. Stephan und Herr S. Freudenberg, NCCM Dresden, sprachen über „Fachkräftebedarf heute und in Zukunft - Handlungsempfehlung für eine erfolgreiche Bedarfsdeckung in Unternehmen". Wenn sich Unternehmen zukunftsgerichtet und nachhaltig aufstellen wollen, ist ihrer Meinung nach ein Umdenken im Personalmanagement zwingend erforderlich. Instrumente zur Bewusstmachung und Reduzierung von Alters-, Gender- und Herkunftsdiskriminierung werden dringend benötigt. Vielfalt sollte als Chance verstanden werden. Damit sind - auch kurzfristige - Lösungen des Fachkräftebedarfs möglich.
Sandro Freudenberg vom NCCM Dresden im Workshop „Unternehmen suchen Fachkräfte – Fachkräfte suchen Unternehmen"
Die Präsentation von Frau Dr. Kateřina Maršíková, Technische Universität Liberec / Tschechische Republik, zum Thema „Prospects of university graduates and their value for employers and labour market" ergänzte sehr gut den ersten Vortrag, weil die Situation und Erwartungen von Hochschulabsolventen in verschiedenen europäischen Ländern sowie der Tschechischen Republik im Mittelpunkt standen. Auf der Grundlage empirischer Daten wurden die Faktoren Arbeitslosigkeit, Qualifikation, Einkommensniveau und Präferenzen der Absolventen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt bewertet. Wichtige Faktoren bei der Wahl des Arbeitgebers sind für die Absolventen der Inhalt ihrer künftigen Arbeit, der Standort des Arbeitgebers, das Einkommensniveau sowie die Gestaltung der Arbeitszeiten.
Frau Ruey Komulainen, University of Applied Sciences Kajaani / Finnland, welche online zugeschaltet wurde, sprach über „Employer Branding for Small and Mediumsized Enterprises: Attracting Graduating Students in IT Industry". Auf der Basis einer eigenen empirischen Erhebung bei finnischen IT-Dienstleistern hat sie untersucht, inwiefern das personalwirtschaftliche Konzept Employer Branding auch in mittelständischen IT-Firmen zur Gewinnung und Bindung junger Nachwuchskräfte geeignet ist. Attraktive Arbeitgeberattribute sind lt. der Befragung von finnischen Studierenden ähnlich wie die Erwartungen von Studierenden in anderen Ländern an Arbeitgeber. Am wichtigsten sind solche Faktoren wie gute Karrierechancen, ein wettbewerbsfähiges Einkommen sowie eine freundliche und offene Arbeitsumgebung, die innovatives und kreatives Denken fördert und Kompetenzen schätzt und belohnt.
Frau Prof. Kauf von der Universität Oppeln/Polen stellte in ihrem Vortrag „Die Unternehmensanforderungen an die Logistikspezialisten und an die akademische Ausbildung der Logistiker" dar, wie der wachsende Logistiksektor europaweit entweder eher ingenieurwissenschaftlich oder betriebswirtschaftlich ausgebildete Absolventen benötigt, wobei beide Ausbildungswege gleichwertig sein können. Außerdem betonte sie den zentralen Aspekt der Fähigkeit der Absolventen zu Interdisziplinarität.
Volkswirtschaftliche Vorträge
Im ersten volkswirtschaftlichen Workshop stellte Prof. Kolev, WHZ, zunächst die Frage „Ageing society and its labour market: is demography more than just a threat?". Seiner Meinung nach kann man sich durchaus auch eine erfolgreiche aber schrumpfende Gesellschaft vorstellen. Ebenso sei es vollkommen zweifelhaft, ob eine Fortschreibung der bisherigen demografischen Entwicklung auf die kommenden Jahr-zehnte zulässig ist. Prof. Kolev stellte besonders in den Vordergrund, dass eine alternde und schrumpfende Gesellschaft durchaus auch zu mehr Individualismus und Subsidiarität führen kann. Die befürchteten Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt teilte er daher nicht, ganz im Gegenteil. Wie Prof. Wrobel in seinem Beitrag „The German labour market between skill shortage and immigration – ordoliberal perspectives" deutlich machte, kann auch Einwanderung die möglichen Probleme des Fachkräftemangels nicht dauerhaft beseitigen, sondern lediglich abschwächen. Dafür muss die Immigration nach Deutschland einerseits möglichst viele Freiheiten für die Migranten beinhalten, andererseits aber durch einen Ordnungsrahmen ökonomisch gesteuert sein, z.B. durch ein transparentes Einwanderungsgesetz, das v.a. für die internationale Arbeitsmigration einen Rahmen setzt.
Vortrag von Prof. Sepp
Internationale Vergleiche brachten insbesondere die beiden Kollegen aus Estland. Prof. Sepp, Universität Tartu, stellte in seinem Vortrag „"The development and typology of the employment structure in OECD countries" eine Cluster-Studie dar, in welcher er die unterschiedlichen Wege zur Tertiarisierung in den Ländern der OECD anhand von Arbeitsmarktdaten vorstellte. Es zeigte sich dabei klar, dass die Pfade hin zu einer modernen Dienstleistungsgesellschaft und den Entwicklungen des Arbeitsmarktes auf dem Weg dorthin durchaus sehr unterschiedlich ausfallen können. Prof. Eamets, ebenfalls von der Universität Tartu, machte in seinem Vortrag „Mapping flexicurity systems from the point of youth unemployment" deutlich, dass insbesondere in Nord- und Mitteleuropa eine Kombination von Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt und sozialer Absicherung in und nach der Wirtschaftskrise von 2008 für die Beschäftigung junger Arbeitnehmer erfolgreich war, während die Länder Mittel- und Osteuropas sowie Südeuropas hier eher versagten. Besonders intensiv wurde dabei auch die Frage der Übertragbarkeit von Arbeitsmarkterfahrungen einzelner Länder auf andere Länder mit anderen institutionellen Gegebenheiten diskutiert.
Zwei polnische Kollegen konzentrierten sich auf die Aspekte nachhaltigen Wirtschaftens und ihren Zusammenhang mit Arbeitsmärkten. Während Prof. Michał Ptak, Breslauer Universität für Wirtschaft, in seinem Vortrag „Green jobs in the renewable energy sector" aufzeigte, dass der Ausbau erneuerbarer Energien auch in Polen zahlreiche neue Arbeitsplätze schaffen kann, bestätigte dies Frau Dr. Paradowska von der Universität Oppeln für den Transportsektor, der trotz der enormen Veränderungen in den Wertschöpfungsketten nach wie vor als ein boomender Sektor mit zunehmend europaweiter Bedeutung zu sehen ist.
Für großes Interesse sorgten auch die beiden Kollegen aus Südkorea, welche eine komplett andere Perspektive auf Arbeitsmärkte einbringen konnten. So machte PD Dr. Seliger von der Hanns-Seidel-Stiftung in Seoul in seinem Vortrag „North Korean workforce abroad: China, Middle East, Russia" deutlich, wie „Leiharbeiter" aus Nordkorea weltweit einerseits ausgebeutet werden, andererseits so aber ein deutliches besseres Leben als der Durchschnitt der Arbeiter in Nordkorea haben. Dies ergänzte Prof. Dr. Seo, GEODIS Wilson in Seoul, in seinem Vortrag über die „Die Sonderwirtschaftszone Kaesong und ihr Arbeitsmarkt". Nach Einblicken in die Besonderheiten der Arbeitsabläufe in nordkoreanischen Betrieben stellte er dar, wie dieses koreanische Kooperationsprojekt nicht nur von politischer Bedeutung ist, sondern auch für die Arbeitskräfte vor Ort eine hervorragende Chance zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen in dem armen und verschlossenen Land, sowie ein wichtiger Pfeiler in der Sicherheitsarchitektur der Region ist.
Konferenzveranstalter und -teilnehmer
Danksagungen
Das Veranstaltergremium dankt insbesondere den Sponsoren, d.h. der Industrie- und Handelskammer Chemnitz, der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, dem Mentor e.V., aber auch der Fakultät Wirtschaftswissenschaften an der WHZ sowie der Universität Tartu für die freundliche finanzielle Unterstützung. Ebenso danken die Veranstalter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie studentischen Hilfskräften der WHZ für ihr enormes Engagement, ohne das diese Konferenz nicht so ein Erfolg hätte werden können. Ein weiterer Ordnungspolitischer Dialog und eine Fortsetzung des Dialoges zwischen Studierenden und Praktikern regionaler Unternehmen werden sicherlich in absehbarer Zeit folgen.
East Asia and Eastern Europe in a globalized perspective
The South Korean economy lived through very tough times in the past two decades: after the Asian crisis of 1997 and 1998 unraveled the old Korean growth model, a spectacular recovery followed around the turn of the millennium. However, soon the world financial and economic crisis hit Korea hard. Though it could escape from a recession and even grew slightly in 2008, the main crisis year, the Korean economy with its dependence on exports was a tremendous challenge. At the same time, South Korea became a leading member of the G20 and hosted the 2009 summit of this powerful organization. All the time, the North Korean threat hung like a Damocles sword over the region, hampering severely South Korean economic stability.
This situation was the background for the conference “East Asia and Eastern Europe in a globalized perspective: lessons from Korea and Estonia”, which convened at the University of Tartu in Estonia on April 24-27. The conference was organized by Dr. Bernhard Seliger of Hanns-Seidel-Foundation Korea together with Prof. Dr. Urmas Varblane and Prof. Dr. Jueri Sepp of the University of Tartu and Prof. Dr. Ralph Wrobel of the West Saxon University in Zwickau, Germany. The organization of the conference was made possible by a generous grant of the Academy of Korean Studies in Korea. It brought together leading European, American, Asian and Korean scholars to discuss the potential lessons from economic development of Korea and Estonia. The rector of the University of Tartu Volli Kalm, as well as the dean of the Faculty of Economics Maaja Vadi, welcomed around 30 scholars at the Oeconomicum, the building of the Faculty of Economics, in the university, which has a 300 year history as a center of learning in Northeastern Europe, reaching far beyond the Baltic region.
In the first session Prof. Dr. Park Sung-Jo, emeritus chair professor of Free University Berlin, revisited the developmental state in Korea in the 1960s and 1970s and the emergence of the coordinated market capitalism in Korea. Aidan Foster-Carter of the University of Leeds in the United Kingdom looked at South Korean development lessons as myths, realities and prospects. Prof. Dr. Joachim Ahrens of Private University of Applied Sciences Goettingen in Germany discussed the role of institutions and the state for economic catching-up. The session was chaired by Prof. Dr. Urmas Varblane of the University of Tartu.
In the next session Dr. Yoon Deok-Ryeong of the Korean Institute for International Economic Policy (KIEP) looked specifically at the Korean performance in financial crises and some implications for East European countries. Prof. Dr. Herman W. Hoen of University of Groningen in the Netherlands asked, if the financial crises in emerging markets would lead to convergence of institutional change. Erkki Karo and Rainer Kattel of Tallinn Technical University looked at the limits of policy emulation in development policies between East Asia and Eastern Europe. The discussions, chaired by Prof. Dr. Park Sung-Jo, centered round the question how far there could be role models and institutional learning and this discussion also was prevailing during all the other sessions.
The last session of the first day of presentations, chaired by Prof. Dr. Ralph Wrobel, dealt in particular with ideas of welfare and welfare states in East Asia and Europe. Prof. Dr. Ari Kokko of Copenhagen Business School in Denmark presented the Swedish welfare state as an attractive solution to the problems of reconciling growth and equality. Though the Swedish welfare state also knew its crises, it was remarkably resilient during the current half decade of world economic crisis. Prof. Dr. Karmo Kroos of the Estonian Business School in Tallinn looked at developmental welfare capitalism in East Asia and the Eastern European market economies. Prof. Dr. Sven Hort, currently working at Seoul National University, looked at welfare systems in Estonia and Korea in a global perspective, in a paper co-authored by Kichae Min, Jolanta Aidukaite, and Zhanna Kravchenko.
In the first session of the second day, chaired by Prof. Dr. Jueri Sepp of University of Tartu, a lively discussion was started by the presentation of Prof. Dr. Ralph Wrobel on economic models for newly industrializing countries. Could and should model constructs like “Nordic welfare states”, “free market capitalism” or “Social Market Economy” serve as models for other countries? Under what conditions could these economic systems (or parts therefore, as Prof. Kokko reminded, referring to the “smoergasboard theory”, which means countries only pick certain, working institutions, not necessarily a whole package) serve as models, if at all? Dr. Bernhard Seliger of Hanns-Seidel-Foundation Korea analyzed changes in South Korean economic institutions after the Asian crisis of 1998, focusing on relations of formal and informal institutions, institutional competition and cultural embeddedness of institutions. While from the outside, the Korean economy seems to have mastered the Asian crisis and the subsequent world financial crisis quite well, nevertheless many Koreans are in search for a new economic system.
The second session looked at industrial structure and policy in Korea and was chaired by Dr. Yoon Deok-Ryong of KIEP. Prof. Dr. Jung Dong-Hyeon of the University of Delhi in India, looked into the role, large conglomerates (chaebols) play in the Korean economy. They are vilified as octopuses strangling the economy, but at the same time they are the most important in terms of generating exports, profits, and employment. Dr. Aziz Karimov, of the World Institute for Development Economics Research (WIDER) at United Nations University in Helsinki, Finland, discussed industrialization and industrial policy in South Korea. Prof. Dr. Nir Kshetri, of the University of North Carolina at Greensboro, USA, spoke about the emergence of successful entrepreneurial ecosystems.
The last session, chaired by Dr. Bernhard Seliger of Hanns-Seidel-Foundation Korea, discussed sectoral policy issues as well as the external environment for South Korea`s economic development. Prof. Dr. Janno Reiljan of University of Tartu, in a paper co-authored by Ingra Paltser, compared the implementation of R&D policies in European and Asian countries. Raigo Ernits, doctoral candidate at the University of Tartu, focused on industrial development on the regional level in Korea and Estonia. The last presentation, by Dr. Henrik Mattson, currently working at the Academy of Korean Studies in South Korea, co-authored by Prof.Dr. Ari Kokko, dealt with economic reform in North Korea.
The conference, which was the fifth conference in the series “Dialogues on Social Market Economy”, organized by Prof. Dr. Jueri Sepp, Dr. Bernhard Seliger and Prof. Dr. Ralph Wrobel, showed that the debate about economic systems, though today rather neglected in many economic curricula, still is raging and indeed came to the forefront of economic policy-making again after the world financial crisis, though often disguised in much more limited terms like reform of the financial sector. The cross-regional comparative study of problems, here that of Korea and Estonia, was a very useful approach; not in the meaning of a one-way relationship but as a source of comparative learning. The organizers are hoping to continue this dialogue in the future.
Innovationssysteme und Wohlstandsentwicklung in der Welt
Bereits zum vierten Mal trafen sich Wissenschaftler aus aller Welt an der Westsächsischen Hochschule, um über die Soziale Marktwirtschaft und das ihr zugrunde liegende wirtschaftspolitische Konzept der Ordnungspolitik zu diskutieren. Mit dem Thema: „Innovationssysteme und Wohlstandsentwicklung in der Welt“ stand diesmal die Fähigkeit von Wirtschaftssystemen, Innovationen hervorzubringen, im Vordergrund. Zum zweiten Mal wurde die Konferenz durch die Universitas-Initiative von Hanns Martin Schleyer Stiftung und Heinz Nixdorf Stiftung gefördert. Dank der guten Zusammenarbeit von PD Dr. Bernhard Seliger (Universität Witten-Herdecke / Hanns Seidel Stiftung, Seoul / Südkorea), Prof. Dr. Jüri Sepp (Universität Tartu, Estland), Stefan Kolev (Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut, Erfurt) sowie Prof. Ralph Wrobel von der Westsächsischen Hochschule ist der Ord-nungspolitische Dialog langsam eine fest etablierte Konferenzreihe mit internationaler Ausrichtung. Dank der finanziellen Unterstützung war es auch in diesem Jahr möglich, Gäs-te aus Europa und Asien für die Veranstaltung zu gewinnen. Durch die Beteiligung von fachfremden Wissenschaftlern wie Ingenieuren oder Architekten war auch für einen inter-disziplinären Diskurs gesorgt.

Plenarsitzung in der Westsächsischen Hochschule, Zwickau
International und interdisziplinär

Prof. Dr. Meissner in der Plenarsitzung
An dem Kolloquium nahmen insgesamt 20 Wissenschaftler und Praktiker aktiv teil. Sie kamen diesmal aus Deutschland, Estland, Polen und Südkorea, was durch die Stiftungsfinanzierung ermöglicht wurde. Damit waren die regionalen Schwerpunkte Deutschland selber, aber auch Mittel- und Osteuropa sowie Ostasien, wodurch interessante Vergleiche möglich ren. Als besonders konträrer Diskussionspunkt ergab sich z.B. die Frage, ob die Soziale Marktwirtschaft nur für Deutschland oder Europa ein optimales Innovationssystem darstellt, in Ostasien hingegen Marktwirtschaften mit direkten staatlichen Eingriffen (z.B. Korea, China etc.) erfolgreicher sein können. Dies wurde z.B. durch den Beitrag von Prof. Dr. Chang aus Seoul bestätigt. Desweiteren bildete das Thema Energie und Klimawandel einen erheblichen Schwerpunkt der Tagung. Eine Präsentation auf der Plenarsitzung, drei Arbeitsgruppenvorträge und der Praktikervortrag beschäftigten sich mit diesem Themenbereich. Daneben den die Besonderheiten von Innovationssystemen in kleinen Ländern wie Estland ebenso diskutiert wie die Innovationsfähigkeit Chinas.
Bereits auf der Plenarsitzung an der Westsächsischen Hoch-schule sprach Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Meissner, Crystalsol, Wien / Österreich über die „Rettung des Klimas und nachhaltige Energieversorgung – Essentielle Randbedingungen für ein nach-haltiges Wirtschaften im 21. Jahrhundert". Ihm folgte Prof. Dr. Urmas Varblane, Universität Tartu / Estland, mit einem völlig anderen Thema: "European Research Area – Interactions between Excellence and Cohesion", worin er eine fünfte Frei-heit für den Europäischen Binnenmarkt forderte, die Freiheit des wissenschaftlichen Austausches.
Brückenschlag zwischen Ökonomie und anderen Wissenschaften

Architekt Jörg Gerl
Für die Veranstalter war eine Kooperation mit Ingenieur- oder Naturwissenschaftlern nicht neu, da sie bereits beim 3. Ordnungspolitischen Dialog 2009 so durchgeführt worden war. Diesmal wurden neben einigen Ingenieuren auch ein Architekt und ein Historiker eingeladen. Der interdisziplinäre Ansatz wurde insbesondere bei dem Thema Energiepolitik und Klimawandel deutlich. Dieser Teil der Konferenz war sicher aufgrund der aktuellen Diskussion zum Atomausstieg in Deutschland für alle Teilnehmer am interessantesten. Neben dem genannten Plenarvortrag von Prof. Meissner beschäftigten sich auch die Vorträge von Stefan Kolev („Ordnungspolitik als Brücke zwischen Innovation und Nachhaltigkeit"), Janina Jänsch („Effiziente Klimaschutzpolitik durch eine Einbindung von Senken in den internationalen Emissionsrechtehandel"), Prof. Dr. Ralph Wrobel („Energiewende ohne Markt? Ordnungspolitische Perspektiven") und PD Dr. Bernhard Seliger („Die "Green Growth Policy" in Südkorea – verschleierter Keynesianismus, paternalistische Wachstums- oder grüne Ordnungspolitik?") mit dem Themenbereich.
Eine hervorragende Ergänzung stellte zudem der Vortrag von Herrn Jörg Gerl, Architekt aus Erfurt dar. Anhand eines konkreten Bauprojektes erläuterte er die technischen Möglichkeiten zur Wärmedämmung und überschlug dadurch die Kosten für die deutsche Gesellschaft. Gerade in diesem Themenbereich wurde zudem die unterschiedliche Sichtweise von Ökonomen und Ingenieuren deutlich, während erstere in Kosten-Nutzen-Erwägungen denken, geht es letzteres um naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten. So kam es in der Diskussion zunächst zu Konflikten und Missverständnissen, die aber im Verlauf ausgeräumt werden konnten. Als Ergebnis konnten sowohl Ökonomen als auch Ingenieure von der gemeinsamen Diskussion im Kolloquium profitieren.
Arbeitsgruppensitzungen
Neben den bereits erwähnten Vorträgen und Diskussionen – insbesondere zur Umweltproblematik – standen weitere Vorträge, die sich mit Einzelfragen der Innovationsfähigkeit beschäftigten. Neben dem einführenden Vortrag von Martin Effelsberg („Die Absorptionsfähigkeit von nationalen Innovationssystemen – Konzeption, Möglichkeiten der Operationalisierung und Implikationen") ist insbesondere auf die eher theoretisch ausgerichteten Beiträge von Prof. Dr. Joachim Ahrens / Patrick Jünemann („China’s Institutional Fabric and its Future Development Trajectory: Institutional Complementarities and Innovative Capacity in China") oder Prof. Dr. Joost Platje („Institutional capital – creating capacity and capabilities for transitions to sustainable development") zu verweisen. Hinzu kamen die anschaulichen Vorträge zur Innovationsfähigkeit Estlands von Prof. Dr. Jüri Sepp / Ülle Maidla („Institutionelle Innovationen im Bereich der Universaldienste in Estland"), Kärt Rõigas ("The Linkage between Productivity and Innovation in Estonian Service Sectors") und Dorel Tamm Ph.D. / Kadri Ukrainski Ph.D. („Functional Side of Systems of Innovation Approach: a Small Country Perspective". In diesen Vorträgen wurden ganz besonders die Anforderungen an ein Innovationssystem in einem kleinen Land deutlich. Letztendlich sei auch noch auf den innovativen Beitrag von Prof. Dr. Dr. h.c. lic. jur. Jürgen Backhaus unter dem Titel „Das Finanzamt als Bankier für Risiko-Unternehmungen" verwiesen, in dem die Möglichkeiten einer Risikofinanzierung durch staatliche Stellen diskutiert wurden. Alle Beiträge fanden Widerhall in den intensiven Diskussionen, für die das Programm ausreichend Raum vorsah. Gerade diese Diskussionen waren aber die wichtigsten Bestandteile des gesamten Kolloquiums.

Arbeitsgruppensitzung: Prof. Dr. R. Wrobel und PD Dr. B. Seliger
… und zum Schluss
Um neben den internationalen und interdisziplinären Ansätzen auch die Praxis einzubezie-hen, wurde eine Besichtigung des VW-Werkes in Zwickau-Mosel durchgeführt. Nachdem die Teilnehmer mehrere Tage über Innovationen und technischen Fortschritt diskutiert hatten, konnten sie nun auch solchen in der Praxis erleben. Insbesondere für die Ökonomen und die Gäste aus dem Ausland war die Besichtigung des Werkes ein weiterer Höhepunkt der Veran-staltung. Das sehr moderne VW-Werk konnte so als Anschauungsbeispiel für innovatives Arbeiten zwischen Ingenieurwissenschaften und Ökonomie genutzt werden. Durch den kontinuierlich steigenden Erfolg sind die Veranstalter bestärkt in ihrem Glauben, die ordnungspolitisch orientierte Konferenzreihe weiterzuführen. Allerdings wird ab sofort auf einen Zweijahresrythmus gewechselt. Die Folgekonferenz, der 5. Ordnungspolitische Dialog, wird dann voraussichtlich im Mai/Juni 2013 in Zwickau durchgeführt werden. Die Veranstalter denken bereits über die Thematik nach.
Die Sozialen Marktwirtschaft als Vorbild in internationalen Krisen
Wissenschaftler aus aller Welt trafen sich erneut an der Westsächsischen Hochschule, um über die Soziale Marktwirtschaft und das ihr zugrunde liegende wirtschaftspolitische Konzept der Ordnungspolitik zu diskutieren. Mit dem Thema: „Die Soziale Marktwirtschaft als Vorbild in internationalen Krisen: ökonomischer und technologischer Wandel von 1989 bis 2009“ standen diesmal die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise sowie das Zusammenspiel von Wirtschaft und Technik im Vordergrund. Zum ersten Mal wurde die Konferenz durch die Universitas-Initiative von Hanns Martin Schleyer Stiftung und Heinz Nixdorf Stiftung gefördert. Dank der guten Zusammenarbeit von PD Dr. Bernhard Seliger (Universität Witten-Herdecke / Hanns Seidel Stiftung, Seoul / Südkorea), Prof. Dr. Jüri Sepp (Universität Tartu, Estland), PD Dr. Joachim Zweynert (Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut, Erfurt) sowie Prof. Ralph Wrobel von der Westsächsischen Hochschule kam die internationale Konferenz bereits zum dritten Mal in Folge zustande. Dank finanzieller Unterstützung war es in diesem Jahr möglich, nicht nur Gäste aus ganz Europa, sondern sogar auch aus Asien für die Veranstaltung zu gewinnen. Durch die Beteiligung zahlreicher Ingenieure war auch für einen interdisziplinären Diskurs gesorgt.
Plenarsitzung in der Westsächsischen Hochschule, Zwickau
Zentrale Veranstaltung war die öffentlichen Plenarsitzung, zu der herausragende Redner begrüßt werden konnten: Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Arnold von der Fernuniversität Hagen sprach über neuere Entwicklungen der Wirtschaftsethik. („Vom Sollen zum Wollen – über neuere Entwicklungen in der Wirtschaftsethik“) Der Geschäftsführer Finanz und Controlling der Volkswagen Sachsen GmbH, HerrDipl.-Volkswirt Robert Stauß, analysierte daraufhin die Auswirkungen der „Abwrackprämie“ auf die Innovationstätigkeit der deutschen Automobilindustrie („Die Auswirkungen des Konjunkturprogramms II auf die Innovationstätigkeit der deutschen Automobilbranche“). Abschließend referierte der Direktor des Instituts für Technologie an der Universität Tartu in Estland, Dr. Erik Puura, anhand des estnischen Beispiels über die technologische Entwicklung in Transformationsländern („Technology Development and Innovation in Transforming Economy: Estonian Example”). Bereichert wurden die Vorträge durch die zahlreichen Fragen und Diskussionsbeiträge der Kollegen und Studierenden der Westsächsischen Hochschule, die zur Plenarsitzung eingeladen waren.
In weiteren Arbeitsgruppen diskutierten die Forscher vielseitige aktuelle ordnungspolitische Fragen. Hier eine Übersicht der Vorträge in den Arbeitsgruppen:
- Arbeitsgruppe:„Institutional Change in the Financial- and Economic Crisis“
Seliger, Bernhard - Clusters as an instrument of economic policy – public policy, institutions, and knowledge
Ahrens, Joachim - Adaptive efficiency and pragmatic flexibility: characteristics of institutional change in capitalism, Chinese-style
Schumann, Christian-Andreas / Rutsch, Andreas - Postponement and the Wealth of Nations
- Arbeitsgruppe: „Die Soziale Marktwirtschaft als Vorbild bei der Transformation von Wirtschaftssystemen und der Reform von Wohlfahrtsstaaten“
Maidla, Ülle / Sepp, Jüri - Eine Typologie von Gesellschafts- und Wirtschaftsordnungen nach dem Human Development Report und die Position der Transformationsländer
Kolev, Stefan - Der bulgarische Weg seit 1989: Wachstum ohne Ordnung?
Wolosz, Mario - Das kasachische Steuersystem zwischen importierten Rechtsnormen und eigenen Traditionen
Backhaus, Jürgen - Öffentliche Unternehmen in der sozialen Marktwirtschaft: Fremdkörper oder die Hefe im Teig?
Arbeitsgruppensitzung im Konferenzraum
- Arbeitsgruppe: „Technology and the Economics of Innovation“
Kim Gi-Eun - Technology Innovation & Green Policy in Korea
Tamm, Dorel - Discussion of existing system failures in public sector innovation support measures: The case of Estonian dairy industry
Roos, Andro - Co-operative Banking as the facilitator of regional innovation system
- Arbeitsgruppe: „Ordnungspolitik vor und nach der Finanz- und Wirtschaftskrise“
Zweynert, Joachim – Die preußischen und südwestdeutschen Reformen nach 1806 und ihre ordnungspolitischen Implikationen
Meijer, Gerrit – Neoliberalism: Neoliberals on economic order and economic theory
Wrobel, Ralph – Geldpolitik und Finanzmarktkrise: Das Konzept der „unabhängigen Zentralbank“ auf dem ordnungspolitischen Prüfstand
Clapham, Ronald - Wirtschaftswissenschaft im Zeitalter der Globalisierung
- Arbeitsgruppe:„Regional Aspects of Economic and Technological Development“
Eerma, Diana - Challenges of electricity market liberalization in the Baltic countries
Ernits, Raigo - Structural change on local level: options for policy
Reljan, Janno - Vertiefung der regionalen Unausgeglichenheit der Wirtschaftsentwicklung in Estland
Kim, Jeong-Ho - Spatial Planning and economic development in border regions – the experience of Gangwon Province
Aufgrund der Interdisziplinarität und Internationalität waren die Diskussionen außerordentlich bereichernd und interessant. Immer wieder konnte festgestellt werden, dass sowohl Ökonomen als auch Ingenieure sich mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigen, weltweit ähnliche Probleme diskutiert werden. Dabei wurde deutlich, dass mithilfe des Konzeptes der Sozialen Marktwirtschaft auf viele Fragen befriedigende Antworten und für viele Probleme interessante Lösungsvorschläge erarbeitet werden können.
Impressionen aus dem August-Horch-Museum, Zwickau
Um nicht nur im Elfenbeinturm zu theoretisieren, beinhaltete das Programm auch praxisbezogene Bestandteile. So wurde z.B. unter dem Motto „100 Jahre Automobilbautradition in Zwickau - technologischer Wandel im Osten Deutschlands“ eine Führung durch das August-Horch-Museum in Zwickau durchgeführt. Dabei wurde den Teilnehmern die Bedeutung des Automobilbaus für die Region deutlich gemacht und wieder ein Brückenschlag zwischen Ingenieurwissenschaften und Ökonomie geschaffen. Ebenso um die Region ging es an einem Abend im Kamingespräch mit dem Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Südwestsachsen, Herrn Dipl.-Ing. Hans-Joachim Wunderlich. Herr Wunderlich berichtete insbesondere über die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Region. Dabei konstatierte er, dass die Unternehmen gelassen auf die neuen Herausforderungen reagierten. Die Menschen in der Region seien den Umgang mit Krisen gewohnt. Sie würden auch diese meistern.
Gruppenbild mit Damen
Insgesamt wurde die Konferenz von Teilnehmern und Veranstaltern als großer Erfolg bewertet. Die Veranstalter hoffen deshalb, die Konferenzreihe auch weiterhin mithilfe der Hanns Martin Schleyer-Stiftung und Heinz Nixdorf-Stiftung fortführen zu können, um den ordnungspolitischen Ansatz nicht nur in Deutschland zu stärken, sondern die Idee der Sozialen Marktwirtschaft auch aktiv ins Ausland exportieren zu können.
Chancen und Risiken für die Soziale Marktwirtschaft im internationalen Wettbewerb der Wirtschaftssysteme
An der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) fand vom 20. bis 21. November 2008 unter der Leitung von PD Dr. habil Bernhard Seliger, Seoul (Korea), Prof. Dr. Jüri Sepp, Tartu (Estland) und Prof. Dr. Ralph M. Wrobel, WHZ (Deutschland) bereits zum zweiten Mal der Ordnungspolitische Dialog statt. Damit gelang es den Veranstaltern, eine ordnungspolitische Konferenzreihe zu etablieren, die fortgesetzt werden soll. Die Vorträge deckten wieder ein breites Spektrum aus der Wirtschaftspolitik ab. In mehreren Arbeitsgruppen tagten die Wissenschaftler von Donnerstag bis Freitag in Zwickau. Dabei wurde sowohl über das Konzept und die Genese der Sozialen Marktwirtschaft in ihrem 60ten Lebensjahr diskutiert, wie auch über ihre Stellung im aktuellen Wettbewerb der Wirtschaftssysteme. Abschließend wurden Konzepte zur Reform im Wohlfahrtsstaat Deutschland vorgestellt.
 |
 |
 |
| Prof. Dr. Schäfer, Hamburg | Hörsaal I / Campus Scheffelberg | PD Dr. habil. Zweynert, Erfurt |
Plenarvorträge
Wie bereits im vergangenen Jahr begann auch der 2. Ordnungspolitische Dialog mit einer Plenarsitzung, die allen Studierenden der WHZ, Kollegen und dem breiten Publikum offen standen. Mit den zwei ausgesuchten Referenten wurde dem Publikum ein interessantes Spektrum von Themen und Meinungen zu ordnungspolitischen Fragen mit internationalem Bezug geboten. Folgende Vorträge wurden gehalten und mit den Zuhörern diskutiert.
- Dienstleistungsökonomie in Europa: eine ordnungspolitische Analyse (Dokument im PDF-Format) (Prof. W. Schäfer, Hamburg)
- Wettbewerb von Wirtschaftssystemen und der Transfer von Institutionen (PD Dr. J. Zweynert, Erfurt)
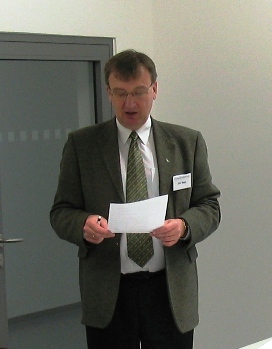 |
 |
 |
| Prof. Dr. Sepp, Tartu (Estland) | PD Dr. habil. Seliger, Witten/Herdecke | Prof. Dr. Wrobel, WHZ Zwickau |
Arbeitsgruppenvorträge
Am Donnerstag Nachmittag sowie am Freitag fanden weitere zahlreiche Vorträge zu ordnungspolitischen Fragen im neuen Konferenzsaal des Institutes für Betriebswirtschaftslehre an der WHZ statt. Die Themen variierten von historischen Fragestellungen, über aktuelle Fragen zur Finanzkrise bis hin zu europäisch oder international vergleichenden Fragestellungen. Folgende Vorträge wurde gehalten:
- Wie wird man ein Liberaler? Die Genese der Idee des Leistungswettbewerbs bei Walter Eucken und Alexander Rüstow (Dokument im PDF-Format) (Uwe Dathe, Jena)
- Theories of economic miracles - a comparative study of the German, Japanese, Korean and Chinese case (Dokument im PDF-Format) (PD Dr. Seliger, Seoul / Südkorea)
- Realwirtschaft und Liquidität (Dokument im PDF-Format) (Prof. Dr. Backhaus, Erfurt)
- Europäische Wirtschaftssysteme durch das Prisma der Branchenstruktur und die Position der Transformationsländer (Dokument im PDF-Format) (Prof. Dr. J. Sepp, Tartu / Estland)
- Neue Kooperationsformen im Innovationsprozess: Strategien für mehr Wettbewerbsfähigkeit von KMUs und für den Aufholungsprozess in Mittel- und Osteuropa (Prof. Dr. R. Hasse, Leipzig - leider kurzfristig ausgefallen!)
- Entstehende Marktwirtschaften in Zentralasien: Die Rolle institutioneller Komplementaritäten in Reformprozessen (Prof. Dr. J. Ahrens, Göttingen)
- Sonderwirtschaftszonen im internationalen Wettbewerb der Wirtschaftssysteme: ordnungspolitisches Konstrukt oder Motor institutionellen Wandels? (Dokument im PDF-Format) (Prof. Dr. R. Wrobel)
- Job Safety first? Zur Veränderung der Konzessionsbereitschaft von arbeitslosen Bewerbern und Beschäftigten aus betrieblicher Perspektive (Dokument im PDF-Format) (Kettner / Rebien, Nürnberg)
- Verkehrspolitik in der Sozialen Marktwirtschaft (Dokument im PDF-Format) (Prof. Dr. F. Fichert, Heilbronn)
- Stubborn Conservatives, Tax Competition and Strategic Deficit (Prof. Dr. Pitsoulis, Cottbus)
Die Teilnehmer der Konferenz konnten wieder einmal ordnungspolitische Fragestellungen im engen Kreis diskutieren. Ihre Ergebnisse stellen Sie online als "Ordnungspolitische Diskurse" zur Verfügung. Kritische Stellungnahmen sind ausdrücklich erwünscht! Insgesamt war die Konferenz ein voller Erfolg. Der 2. Ordnungspolitische Dialog machte deutlich, dass es in Deutschland auch heute aktive Vertreter der Ordnungspolitik gibt. Um ihnen eine zusätzliche Stimme in der wirtschaftspolitischen Diskussion zu geben, wird diese Konferenzreihe deshalb in Zwickau fortgeführt.
Das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft und seine Anwendung: Deutschland im internationalen Vergleich
An der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) fand vom 29. bis 30. November 2007 unter der Leitung von PD Dr. habil Bernhard Seliger, Seoul (Korea), Prof. Dr. Jüri Sepp, Tartu (Estland) und Prof. Dr. Ralph M. Wrobel, WHZ (Deutschland) erstmalig der Ordnungspolitische Dialog statt. Auf der Plenarsitzung, welche nicht nur von den Wissenschaftlern, sondern auch von zahlreichen Studierenden der WHZ sowie vielen Gästen besucht wurde, berichteten diese über das Konzept der Ordnungspolitik, die ordnungspolitischen Erfolge Estlands bzw. die Herausforderung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit durch die „Tigerstaaten“ in Ostasien. Die sächsische Perspektive wurde durch den Regierungspräsidenten von Chemnitz, Herrn Karl Noltze, vertreten.
Auf der Konferenz waren Wissenschaftler aus allen Teilen der Welt vertreten. Sie kamen aus Deutschland, Frankreich, Estland, Russland und Korea. Zweck ihres Treffens war es, das Konzept der „Sozialen Marktwirtschaft“, wie es ursprünglich durch Ludwig Erhard in Deutschland eingeführt worden ist, wieder zu beleben und international bekannter zu machen. Allgemein bedauerten die Wissenschaftler, dass in der heutigen Zeit häufig nur so genannte „Neoliberale“ und „Globalisierungskritische“ Ansätze in der Wirtschaftspolitik zu Wort kommen. Das Konzept der Ordnungspolitik, das eine wettbewerbliche Rahmenordnung für das marktwirtschaftliche Handeln fordert, sei hingegen bedauerlicherweise aus der Mode gekommen. Die Vorträge deckten somit ein breites Spektrum aus der Wirtschaftspolitik ab. In mehreren Arbeitsgruppen tagten die Wissenschaftler dann noch bis Freitagnachmittag. Hier wurde sowohl über die Ansätze der Ordnungspolitik in der deutschen Wirtschaftspolitik diskutiert, wie auch über die Umsetzung des Konzeptes der Sozialen Marktwirtschaft in den Transformationsstaaten Mittelosteuropas sowie den Schwellenländern Ostasiens.
Folgende Vorträge wurden auf der Tagung gehalten:
Plenarsitzung:
- „Ordnungspolitik und das Ordnungspolitische Portal“ (Prof. Dr. Ralph Wrobel, WHZ)
- „Die ordnungspolitische Strategie des Landes Sachsen im internationalen Standortwettbewerb“ (Herr Karl Noltze, Regierungspräsident Chemnitz)
- „Transformation in Estland – eine ordnungspolitische Erfolgsgeschichte“ (Prof. Dr. Jüri Sepp, Universität Tartu / Estland)
- „Die Ordnungspolitik der ostasiatischen Tigerstaaten als Herausforderung für die deutsche Wettbewerbsfähigkeit“ (PD Dr. habil. Bernhard Seliger, Hanns-Seidel Stiftung, Seoul / Südkorea)
Arbeitsgruppen:
- „Rheinische Wegbereiter der Sozialen Marktwirtschaft: Charakter zeigen im Aufbruch“ (Prof. em. Dr. Dr. Bodo Gemper, Universität Siegen)
- „Staat, Wirtschaften und Governance“ (Prof. Dr. Herbert Strunz, WHZ)
- „Gilt das Coase Theorem auch in den Neuen Ländern?“ (Prof. Dr. Dr. h.c. lic. jur. Jürgen Backhaus, Universität Erfurt)
- “The concept of the Social Market Economy for transition countries" (Prof. Dr. Joachim Ahrens, Private Fachhochschule Göttingen)
- “Big Business and Quality of Institutions in the Post-Soviet Space: Spatial Aspects" (Dr. Alexander Libman, Russ. Akademie der Wissenschaften)
- „Wettbewerb ohne Wettbewerb? Über die Bedeutung von Reformen im Bildungswesen für die Akzeptanz der Wettbewerbsidee in der Ukraine (Uwe Dathe, Friedrich-Schiller-Universität Jena)
- „Welche Bedeutung haben nationale Wirtschaftsordnungen für die Zukunft der EU? Der Beitrag der Sozialen Marktwirtschaft“ (Prof. em. Dr. Ronald Clapham, Universität Siegen)
- „Das modèle rhénan aus französischer Sicht" (Emmanuel Decouard M.A., IEP Chemnitz
- „Wirtschaftspolitische Herausforderungen durch den demographischen Wandel: Deutschland, speziell in Sachsen“ (Prof. Dr. Annedore Sonntag, WHZ)
- „Competition Policy’s Role in Network Industries - Regulation and Deregulation in Estonia“ (Diana Eerma, M.A., Universität Tartu / Estland)
- „Ensuring Competitiveness through innovation in European transition economies“ (Kim Minyong, M.A., Universität Bonn)
- “South Korea's aid to North Korea's transformation process- an assessment to social market perspective“ (Jang Tae Seok, M.A., Universität Kiel)
Am Ende waren sich die Wissenschaftler einig: der 1. Ordnungspolitische Dialog war ein voller Erfolg, der eine Fortsetzung verlangt. Im kommenden Herbst will man sich deshalb wieder in Zwickau zu einem neuen Ordnungspolitischen Dialog treffen. Das Ordnungspolitische Portal wird darüber rechtzeitig informieren.
